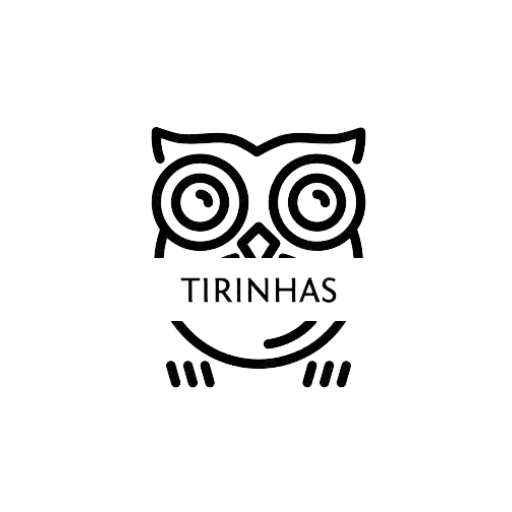[ad_1]
Diese Galerieausstellung Thaddäus Ropac von Paris präsentiert einen sehr spezifischen Blickwinkel auf das komplexe und dichte Werk von Marcel Duchamp (1887-1968). Der Titel, auf Französisch Toucher Priore (Bitte berühren), das der Künstler selbst in einem seiner Werke verwendet hat, drückt eine Umkehrung aus, die auf den in Museen üblichen Hinweis anspielt und ihn in Frage stellt, damit das Publikum die Werke nicht berührt: Bitte nicht berühren.
Fetischismus in all seinen Spielarten, von denen einige nicht ausdrücklich körperlich sind, impliziert immer Kontakt. Und indem wir uns in diesem Bereich positionieren, möchte Paul B. Franklin, Kurator der Ausstellung, hervorhebenDie zentrale Bedeutung des Fetischismus im Leben und Werk von Marcel Duchampder immer wollte, dass das vielfältige Publikum nicht „außerhalb“ seiner Stücke steht, sondern in intensivem und freiem Kontakt mit seinen Stücken steht.
Im Präsentationstext der Ausstellung sagt der Kurator: „Es ist das erste Mal, dass die Bedeutung von Fetischismus und Fetischismus im Werk von Marcel Duchamp untersucht wird.“ Dies bedarf einer kleinen Einschränkung, denn 2016 präsentierte das Tinguely-Museum in Basel eine Ausstellung mit demselben Titel: Bitte anfassenund der Untertitel der Hauch von Kunst, kuratiert von Roland Wetzel. Obwohl der Ausgangspunkt damals Duchamp war, war die Ausstellung natürlich nicht so speziell auf den Fetischismus ausgerichtet und wurde auch mit einem offenen Umgang mit der Präsenz anderer Künstler präsentiert.

Marcel Duchamp: „Akt eine Treppe herabsteigend“, 1937. Rechts M. Duchamp: „Flaschenhalter“, 1965. Fotos: Marcel Duchamp Association / ADAGP, Paris 2022
Diese Version von Bitte anfassen von der Galerie Thaddaeus Ropac in Paris, wurde zum ersten Mal in ihren Londoner Räumen präsentiert. Es ist ohne Zweifel ein Zeichen großen Interesses 34 Werke Grafiken, Objekte, Fotografien und Reproduktionen in Kleinformaten geht auf einige der Fragen ein, die Duchamp zu einem der bedeutendsten Künstler unserer Zeit gemacht haben. Die Ausstrahlung des Fetischismus wird in fünf Abschnitten gegliedert: die Betrachtung des Ready-made als fetischistisches Objekt; seine Präsenz in Miniaturnachbildungen und Reproduktionen; seine Rolle im Genrespiel: die Verwendung fetischistischer Materialien wie Leder, Vinyl, Gummi und Metallpapier und die Entfaltung seiner künstlerischen Identität (bei Marcel und bei Rrose Sélavy).
Kleinformatige Reproduktionen, die von Duchamp selbst angefertigt wurden und in Schachteln mit Mehrfachauflagen und in Luxusausgaben von Katalogen enthalten sind, werfen die Frage auf, wie sie im Verhältnis zu Originalwerken bewertet werden können, da sie, wie Walter Benjamin in den dreißiger Jahren von Im letzten Jahrhundert hätte der Charakter von Kunstwerken seit der Möglichkeit ihrer technischen Reproduktion einen tiefgreifenden Wandel erfahren.
Zu diesem Thema nimmt Paul B. Franklin im Ausstellungskatalog auf, was Duchamp in seinen letzten Lebensjahren sagte: „Die Unterscheidung zwischen Echtem und Falschem, Imitationen und Kopien sind völlig bedeutungslose technische Fragen“ (1967). „Ein Duplikat oder eine mechanische Wiederholung hat den gleichen Wert wie das Original“ (1968). Und danach kommt er zu dem Schluss: „Für Duchamp waren die in einem Kunstwerk verkörperten Ideen von gleicher oder größerer Bedeutung als das physische Objekt selbst.“
Dadurch wird der Charakter des Musterteilesatzes präzise erschlossen. Wir werden vor eine Art Betrachtungsmikroskop gestellt, um uns ein zentrales Merkmal von Duchamps künstlerischem Werk vor Augen und Geist vor Augen zu führen: die Vorherrschaft der Idee gegenüber physischen Stützen. Und daher die Bedeutung, die der Begriff des Fetischismus sowohl in seinem Leben als auch in seiner Arbeit hat.

Blick auf die Ausstellung in der Galerie Thaddaeus Ropac in Paris
Der Begriff Fetisch hat seine etymologischen Wurzeln in Kultgegenständen, denen in bestimmten Kulturen übernatürliche Kräfte zugeschrieben wurden. Doch im Laufe der Entwicklung der europäischen Kultur und mit der intensiven Zurschaustellung von Technologie, die Massenbevölkerungen und -kulturen hervorbrachte, wurde in den Ansätzen der Psychologie und Psychoanalyse der Begriff Fetischismus als Ausdruck dessen geprägt, was damals als „sexuelle Abweichung“ galt. . besteht darin, einen Teil des Körpers oder der Kleidung als Objekt der Erregung und des Verlangens zu betrachten.
Das Wichtigste ist, wie Paul B. Franklin immer wieder betont Der Begriff des Fetischismus hat bei Duchamp einen positiven und offenen Charakter. Damit versuchen wir, die Idee der Anziehung, unabhängig davon, ob körperlicher Kontakt besteht oder nicht, sowohl im Leben als auch in künstlerischen Werken zu verorten, die die Entfaltung des Verlangens als erotische Kraft ermöglicht. Abschließend können wir also mit Duchamp die Idee teilen, dass sowohl das Leben als auch die Kunst Eros sind ... Das sagen uns Marcels Entwicklungen in Rrose Sélavy: Wörter, die auf Französisch klingen, sind sozusagen eine Homophonie Eros c'est la vie. Auf Spanisch: Eros ist Leben.